
„Wer bin ich wirklich?“ Diese Frage stellen sich Menschen häufiger als sonst in Krisensituationen. Wenn „meine“ Existenz nicht mehr so selbstverständlich scheint wie sonst. Wenn mir nicht mehr, wie als Kind noch, selbstverständlich ist, dass ich ewig lebe. Und was man wohl sagen kann: „Wer bin ich?“ – diese Frage, stellen sich nur Menschen, soweit wir das heute wissen. Menschen haben sich Sprache und mit ihr eine zweite Wirklichkeit (aus Worten) erschaffen. Und so lernten sie auch das Wort „Tod“.
Inhaltsverzeichnis
- Wer bin ich wirklich – Vom wir zum Ich
- Wer bin ich – diese Frage kam erst in der Antike auf
- Von nun an hatte Mensch eine unsterbliche Seele
- Gott ist Mensch geworden – zur Zeitenwende in Jesus
- Angesichts nur einen Gottes – wer bin dann ich?
- „Wer bin ich wirklich?“ erstickte schon im Keim
- Vom verzweifelten Ich zum Menschen als Person
Voraussichtliche Lesedauer: 8 Minuten
Wer bin ich wirklich – Vom wir zum Ich
Eine der großen Entdeckungen um die Zeitenwende, in der auch die Bibel entstand, war die Frage nach dem „Ich“. Um die Zeitenwende, wurde sie explizit, überliefert in Texten, gestellt. Im „Wir“ der frühen Kulturen war der Einzelne noch sicher aufgehoben. Der einzelne Mensch war geschützt durch die Gemeinschaft und wuchs in seine natürliche Rolle hinein. Noch erlebte er sich nicht als persönlich verantwortlich für das, was ihm geschah. Weder im Leben noch nach dem Tod. Wenn er sich verliebte, hatte Eros einen Pfeil abgeschossen. Wenn er grollte, wurde er von Ares gelenkt. Die Frage, wer denn ich persönlich sein könnte, wurde wahrscheinlich nicht einmal gedacht, geschweige gestellt. Denn ein einzelnes Ich ist naturgemäß ungleich schwächer als das lebenserhaltende, alle koordinierende Wir. Und dennoch scheint dieses „schwache“ Ich, als es sich zu artikulieren begann, als gefährlich, zersetzend für den Zusammenhalt der Gemeinschaft, erlebt worden sein.
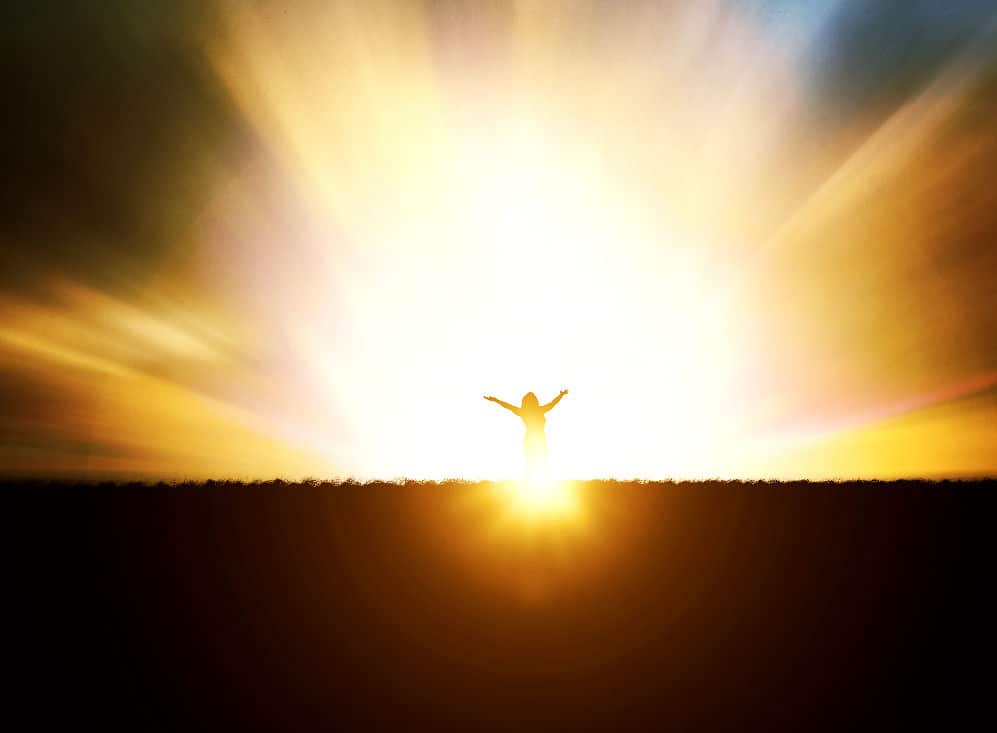
Wer bin ich – diese Frage kam erst in der Antike auf
Frühe Anfänge eines Monotheismus lassen sich sicherlich als Indiz für das werdende Ich deuten. Für Menschen, die „Ich“ denken und sagen können. Und wer „Ich“ denken und sagen lernt, beginnt nach Unterschieden zwischen Ich und seiner Umwelt zu fragen. Vielleicht erlebte sich so mancher schon als jemand, der den entscheidenden Unterschied machen konnte, in einem Krieg, bei einem Bauprojekt. In der griechischen Antike, Walter Ötsch beschreibt die langsame Entwicklung einer Ich-Perspektive in seinen Vorlesungen Schritt für Schritt, begann spätestens mit Sokrates, das Ich seine Eigenständigkeit vehement anzumelden. Das aufkommende Christentum, beschrieben dann in der Bibel, schrieb jedem Menschen eine unsterbliche Seele zu.
Von nun an hatte Mensch eine unsterbliche Seele
Es war (noch) keine individuelle, einzigartige Seele, sondern ein unteilbares Verbundensein mit Gott. Doch von nun an, vorher noch nicht, hatte jeder Mensch eine Seele. Diese Kehrtwende zur Zeitenwende verstehe ich so, dass damals der Anspruch auftauchte, dass Menschen sich ihrer Verantwortung für ihr Leben zu stellen begannen, in diesem Leben und nach dem Tod. Solch damals schon dämmerndes Verantwortungsgefühl von Menschen, indem sie nach sich selbst, nach ihrem Ich fragten, wurde mir durch Jan Assmann sehr viel klarer als zuvor. Es geht, schreibt Assmann, in der Bibel um das Schicksal des konkreten Menschen, das einzelne Ich. Dieses ist der Adressat der Bibel.

Gott ist Mensch geworden – zur Zeitenwende in Jesus
„Der Mensch ist das Maß aller Dinge.“ formulierte zur Blütezeit der griechischen Antike schon Protagoras. Zur selben Zeit bringt Sokrates sein persönliches Daimonion in den philosophischen Diskurs ein. Nicht die Natur ist das Maß aller Dinge. Nicht schaltende und waltende Götter. Sondern der Mensch. Und die frühchristlichen Gnostiker sagen dann: „Homo est deus“ – der Mensch ist Gott. Und mit Jesus, der nach seinem Tod seinen Jüngern erschien, begann die Hoffnung der Menschen auf persönliche Unsterblichkeit. Es ging schon damals um die gleiche Aufgabe, die vor jedem einzelnen Menschen stand wie heute auch oder heute wieder. Sich als Mensch im höchsten Sinne zu erweisen.
Angesichts nur einen Gottes – wer bin dann ich?
Der Fehler oder vielleicht auch die Tragik der Bibel: Der Einzelne und seine persönliche Unsterblichkeit waren nun zwar Thema geworden. Und Menschen, die sich als Ich verstanden, begannen sich Rechenschaft über sich selbst abzulegen. Aber ein Mensch, der sich fragt: „Wer bin ich?“ „Wer bin ich – angesichts eines einzigen Gottes?“ war in seinen Antworten auf diese Frage alles andere als frei. Stattdessen erlebte er sich als hin und her taumelnd zwischen extremen Antwortmöglichkeiten, die beide entsetzlich waren in ihrer Wirkung:
- Ich bin dem einen Gott so nahe, dass nur seine Macht mich mächtig macht.
- Ich bin ohnmächtig ausgeliefert dem einen allmächtigen Gott.
Die Folgen ließen sich auch mithilfe des jetzt erst sich zeigenden Dilemmas zwischen (strukturell verlogenem) Altruismus und (hemmungslos mörderischem) Egoismus beschreiben. Die Lüge-Gewalt-Spirale, in der auch das einzelne Ich durchaus mal die Fronten wechselt, wenn es denn kann. Ob vermeidbar oder eben nicht, kann man sicher streiten, aber: Zugleich mit der jetzt aufkommenden Frage nach dem Ich und seiner Verantwortung wurden mächtige Antworten gegeben. Allmächtig, vom Allmächtigen selbst, autorisierte Antworten sozusagen.
„Wer bin ich wirklich?“ erstickte schon im Keim
Die aufkommende Frage „Wer bin ich wirklich?“ wurde, um es noch deutlicher zu formulieren, im Keim erstickt. Indem erlaubte Antworten vorgegeben und bei Strafe der Ächtung durchgesetzt wurden. Von „Homo est Deus“ ist denn auch in der schließlich kanonisch gewordenen Bibel keine Rede mehr. Keinesfalls! Nur der eine Gott ist ein Gott. Und dieser eine duldet keine Götter neben sich. Der eine Gott ist ein bis dato unbekannt eifersüchtiger Gott, wie vor allem Jan Assmann in „Die Gewalt des einen Gottes“ ausführlich beschreibt.
Und dann gibt es noch etwas, was für mich sogar besonders erhellend war: Dieser eine, allmächtige Gott duldet es nicht, beobachtet zu werden. Er, der alle und alles beobachtet, verweigert den Menschen, verweigert auch denen, die ihn inbrünstig lieben, ihn zu beobachten. Gottes Wege sind unerforschlich. Der Mensch, obgleich nun mit seinem neuen Ich-Bewusstsein und der Frage: „Wer bin ich?“ im Gepäck, ist ohnmächtiger als zuvor. Aus Ohnmacht folgt nicht immer, aber sehr oft, Gewalt als Mittel, die zum Überleben notwendige Macht über sich selbst zurückzugewinnen. Und zu verteidigen.
Vom verzweifelten Ich zum Menschen als Person
Moderne spirituelle Konzepte wie Θελημα oder auch der Philosoph Markus Gabriel im oben stehenden YouTube-Video knüpfen in Bezug auf die zentrale Rolle des Ich an die Bibel an und gehen darüber einen kleinen entscheidenden Schritt hinaus. Das kleine, mit sich selbst beschäftigte Ich, das dem großen Ganzen gegenüber steht, erweist sich als ein folgenreicher Denkfehler der Philosophie. Der Mensch, so Gabriel, ist nicht getrennt von der Natur, dem Ganzen, der Gesellschaft, sondern immer schon mittendrin. Dass er über sich nachdenkt, macht seine Besonderheit aus und verbindet ihn mit jedem anderen Menschen.
Und so wird, da folgt Gabriel dem Aufklärer Immanuel Kant, jeder Mensch zu einem Vertreter der Menschheit. Jeder von uns ist für sich selbst ein großes Thema, denn er trägt die große Frage mit sich herum, was es heißt, ein Mensch zu sein. „Die Aufklärung“, so Markus Gabriel, „ist der Gedanke, dass es so etwas gibt wie die Menschheit oder Kants kategorischer Imperativ: Handle so, dass Du die Menschheit, sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel brauchest.“ Oder, in einer Metapher, die mit Θελημα in die Welt gekommen, ist: „Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern.“
Quellen
- Text: Jan Assmann zu Monotheismus und Gewalt / Was ist Religion? / Walter Ötsch Vorlesungen / Markus Gabriel / Immanuel Kant (bezahlter Link) / Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Die Links zu Amazon sind „bezahlte Links“ im Rahmen vom Amazon Affiliate-Partnerprogramm.
- Bilder: © Stefan Keller from Pixabay / kevron2002 von Deposit / Gerasimov_foto_174 von Deposit

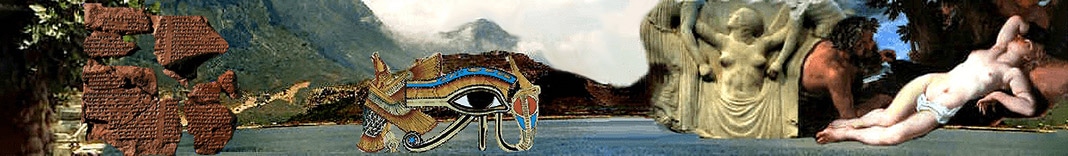






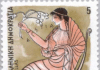

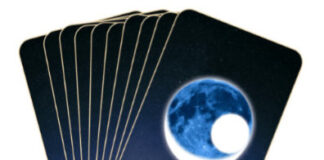
Genauso warnt auch C.G. Jung vor der Identifizierung mit dem Selbst. Er erwähnt dann einen indischen Meister, eine leuchtende Erscheinung ohne Schatten. Erst als er die Frau des Meisters erblickte, hat er gesehen, wohin der Schatten des Meisters gefallen ist.
Ich denke sich in die Erfahrungen leiten lassen, doch sich selber bleiben und aushalten mit Licht und Schatten ist ein gangbarer Weg.
Beeindruckend, dass diese Ich-Selbst-Gott Linie in vielen Traditionen vorkommt.
Das kleine Ich auf ein größeres ICH zu weiten – wäre in dem Vokabular, das ich verwende, vermutlich ICH + ES + DU.
Das kleine Ich aufzugeben, wie es in vielen Religionen heißt oder gar selbstlos zu werden, scheint mir ein fataler Irrtum.
Oder wie Hermann Hesse in seinem Stufengedicht dichtet:
…
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf und Stufe heben, weiten …
Ich – ICH – Gott / indianisch: ich – der grosse Mensch in mir – der Grosse Geist / C.G. Jung: Ich – Selbst – Gott. Die Stifter der grossen Religionen sind darin als Symbole des Selbst zu sehen. Mich berühren die indianischen Ausdrücke am Meisten. C.G. Jung empfiehlt in seinem Individuationsprozess eine Ich – Selbst – Achse zu entwickeln. Indem den aus dem Unbewussten wirkenden Archetypen Schatten, Anima(-mus) Aufmerksamkeit gewidmet wird und so sich langsam eine Beziehung zum Selbst, zum grossen Menschen in uns, entwickelt. Über die Archetypen hätten wir dann wieder den Bezug zum Götterpanteon.